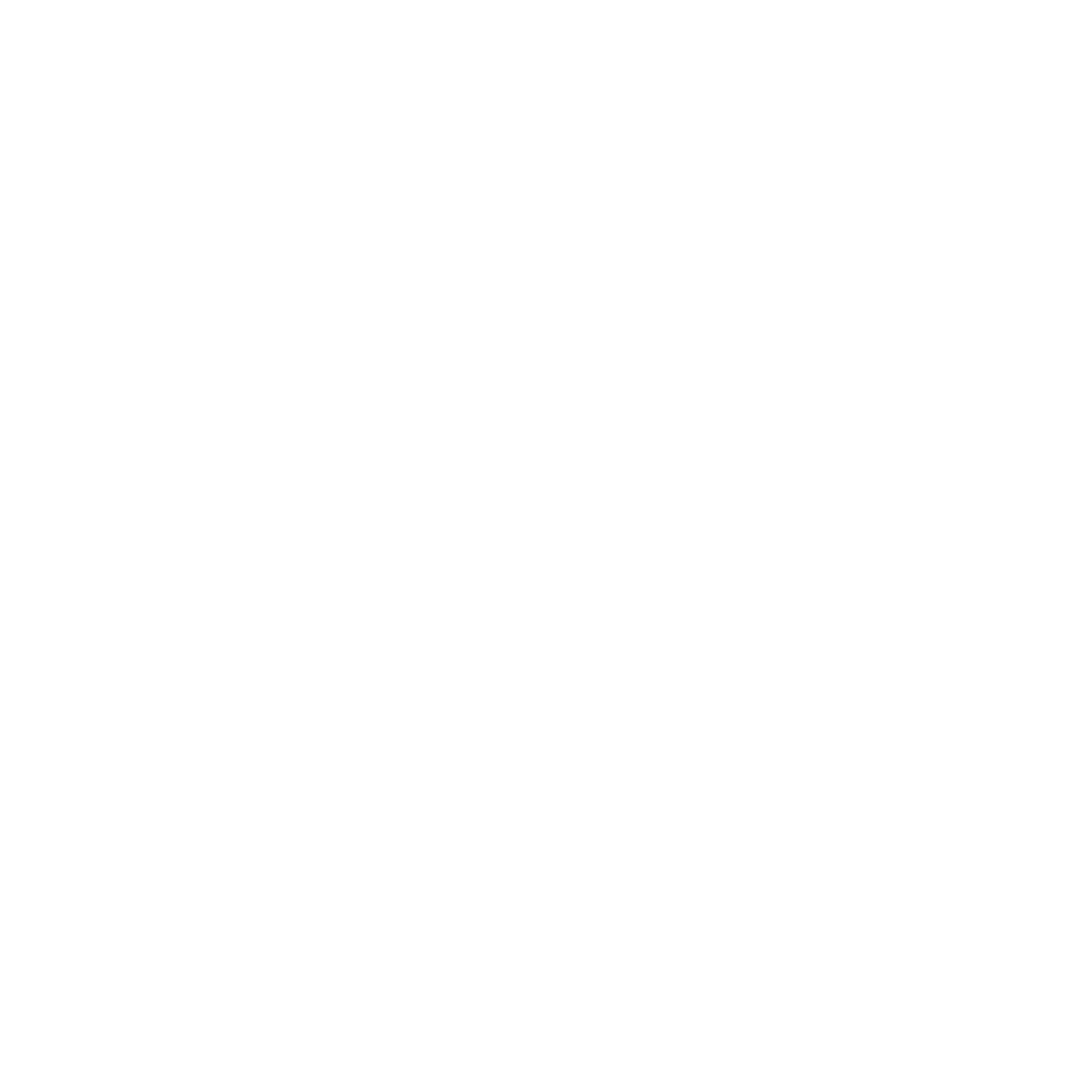Auf dieser Seite finden Sie Antworten auf häufige Fragen und vertiefende Einblicke in meine Leistungen.

Ergänzend wird die Sammlung schrittweise um interessante Themen rund um Energieeinsparung und Sanierung erweitert.

Schließlich noch weiterführende Links zu anerkannten Fachstellen für alle, die sich noch tiefergehend informieren möchten.
FAQ - Häufig gestellte Fragen
Allgemeines
Was ist eine Baubegleitung?
Die energetische Baubegleitung ist ein zentraler Bestandteil bei der Umsetzung von förderfähigen Maßnahmen im Rahmen der Bundesförderung für effiziente Gebäude – Einzelmaßnahmen (BEG EM). Sie dient nicht nur als formale Voraussetzung für den Fördermittelabruf, sondern gewährleistet darüber hinaus die fachgerechte Umsetzung der geplanten Maßnahmen. Durch die unabhängige Kontrolle können Planungs- und Ausführungsfehler frühzeitig erkannt, Bauschäden vermieden und die energetische Qualität der Maßnahme sichergestellt werden – ein wichtiger Beitrag zum langfristigen Werterhalt Ihrer Immobilie.
Nachdem Sie Angebote eingeholt und die Baubegleitung beauftragt haben, prüfe ich die Unterlagen auf Förderfähigkeit. Wenn die technischen Anforderungen erfüllt sind, wird ein Liefer- oder Leistungsvertrag zwischen Ihnen und dem Gewerk geschlossen, der selbst ebenfalls spezifischen Anforderungen unterliegt. Im Anschluss erstelle ich Ihnen eine sogenannte Technische Projektbeschreibung (TPB) oder ein Bestätigung zum Antrag (BzA), das die Fördervoraussetzungen formal dokumentiert. Nach Übermittlung dieses Dokuments an Sie, stellen Sie den Förderantrag beim BAfA oder der KfW, abhängig von der Einzelmaßnahme.
Während der Ausführung der Maßnahme begleite ich die Umsetzung vor Ort und kontrolliere die fachgerechte Ausführung. Nach Fertigstellung prüfe ich die notwendigen Nachweise und erstelle den abschließenden technischen Projektnachweis (TPN) oder die Bestätigung nach Durchführung (BnD). Diesen Nachweis sende ich Ihnen zu, sodass Sie die Auszahlung der Förderung beantragen können. So stellt die Baubegleitung sicher, dass technische und förderrechtliche Anforderungen vollständig erfüllt werden – und schützt zugleich vor Planungsfehlern, Ausführungsmängeln und unnötigem finanziellen Risiko.
Was genau ist ein Energieausweis?
Der Energieausweis dient der transparenten Darstellung des energetischen Zustands eines Gebäudes und ermöglicht Kauf- oder Mietinteressierten den Vergleich verschiedener Immobilien. Er ist ein zentrales Instrument zur Erreichung der Klimaziele 2045 und in der EU gesetzlich vorgeschrieben. In Deutschland wurde er schrittweise seit 2002 eingeführt und ist heute durch das Gebäudeenergiegesetz (GEG) geregelt.
Ein Energieausweis ist erforderlich bei Neubauten, Verkauf, Vermietung, Verpachtung sowie bei größeren Änderungen an der Gebäudehülle. Auch bei öffentlichen Gebäuden mit regelmäßigem Publikumsverkehr besteht Ausweispflicht.
Es gibt zwei Arten: den Energiebedarfsausweis, der auf technischen Gebäudedaten basiert, und den Energieverbrauchsausweis, der auf tatsächlichen Verbrauchsdaten beruht. Welcher Energieausweis für ein Gebäude zulässig ist, ist vom individuellen Gebäude abhängig. Bei einigen Gebäuden besteht auch Wahlfreiheit zwischen den beiden Ausweistypen.
Ein Energieausweis gibt Auskunft über die Energieeffizienz eines Gebäudes und zeigt den Energiebedarf oder -verbrauch in Kilowattstunden pro Quadratmeter und Jahr. Dabei wird zwischen dem Endenergiebedarf – also der Energiemenge, die tatsächlich für Heizung, Warmwasser und Lüftung benötigt wird – und dem Primärenergiebedarf unterschieden, der zusätzlich die Umweltauswirkungen der Energieerzeugung berücksichtigt. Der Ausweis enthält außerdem Angaben zu Treibhausgasemissionen und eine Einordnung in Energieeffizienzklassen von A+ (sehr effizient) bis H (sehr ineffizient), dargestellt in einem farbigen Bandtacho.
Die Modernisierungsempfehlungen im Energieausweis können ein erster Anhaltspunkt für eine Sanierung sein. Jedoch sollte eine umfassende energetische Betrachtung des Gebäudes durch eine Energieberaterin oder einen Energieberater erfolgen. Die Umsetzung kann z. B. mittels eines individuellen Sanierungsfahrplans (iSFP) im Rahmen des Förderprogramms „Energieberatung für Wohngebäude“ erfolgen.
Heizungstausch oder Heizungsoptimierung?
Wer seine Heizungsanlage modernisieren möchte, stößt schnell auf zwei unterschiedliche Fördermöglichkeiten: den Heizungstausch und die Heizungsoptimierung. Beide Maßnahmen verfolgen das Ziel, den Energieverbrauch zu senken und die Effizienz zu steigern, unterscheiden sich jedoch deutlich in Umfang und Förderung.
Ein Heizungstausch bedeutet den Austausch der kompletten Heizungsanlage, also zum Beispiel eines Öl- oder Gas-Brennwertkessels, einer Wärmepumpe oder einer Pelletheizung, durch eine neue, förderfähige Anlage. Diese Maßnahme wird über die KfW gefördert. Da es sich um eine grundlegende Sanierung handelt, die mit hohen Investitionen verbunden ist, ist hier auch der Förderrahmen entsprechend attraktiv. Bei einem Heizungstausch können bis zu 70 % der förderfähigen Kosten bezuschusst werden. Die genaue Förderhöhe ist von der individuellen Situation abhängig und wird gern durch mich für Sie geprüft.
Die Heizungsoptimierung verfolgt einen anderen Ansatz. Hier wird die vorhandene Anlage verbessert und deren Betrieb effizienter gestaltet – etwa durch eine neue Regelung, Anpassungen am System oder den Austausch einzelner Komponenten wie Pumpen. Gefördert wird diese Maßnahme durch das BAFA. Im Unterschied zum Heizungstausch bleibt die bestehende Heizungsanlage erhalten, wird jedoch gezielt optimiert. Die Förderung fällt geringer aus, dafür sind auch die Investitionen überschaubarer.
Der mögliche Zuschuss liegt hier bei bis zu 20 % der förderfähigen Kosten, sofern ein gültiger iSFP vorliegt und das Gebäude nicht mehr als 5 Wohneinheiten hat. Gefördert wird die Optimierung von Heizungsanlagen, die älter als zwei und bei mit fossilen Brennstoffen betriebenen
Heizungsanlagen nicht älter als zwanzig Jahre sind. Die Förderung setzt bei wassergeführten Heizungssystemen ein hydraulisch abgeglichenes Heizungssystem voraus. Sofern ein Heizungssystem nicht abgeglichen ist, muss ein hydraulischer Abgleich nach Verfahren B durchgeführt werden. (Mehr Informationen hierzu auf der Website des VdZ)
Für Hauseigentümer heißt das: Wer seine alte Heizung vollständig ersetzen und dafür von umfangreichen Zuschüssen profitieren möchte, entscheidet sich für den Heizungstausch als BEG-Einzelmaßnahme. Wer hingegen seine bestehende Anlage effizienter machen und dabei von einem kleineren, aber lohnenden Zuschuss profitieren will, wählt die Heizungsoptimierung.
Was hat es mit Luftdichtheit, Schimmel und Lüftungskonzept auf sich?
Eine energetische Sanierung, zum Beispiel durch den Austausch von Fenstern oder durch die Dämmung der Gebäudehülle, führt in der Regel zu einer deutlich höheren Luftdichtigkeit des Gebäudes. Diese Dichtigkeit ist grundsätzlich positiv, da unkontrollierte Lüftungswärmeverluste reduziert werden und somit weniger Heizenergie verloren geht. Gleichzeitig entfällt jedoch auch der unbeabsichtigte Luftaustausch, der früher durch Fugen und Undichtigkeiten ganz von allein stattfand.
Genau darin liegt ein Risiko: Wenn der Luftwechsel nicht mehr ausreichend gewährleistet ist, steigt die Gefahr, dass Feuchtigkeit in den Räumen verbleibt. Diese Feuchte kann sich an kalten Oberflächen niederschlagen und im schlimmsten Fall zu Schimmelbildung führen. Damit wird deutlich, dass mit jeder Verbesserung der Gebäudehülle auch die Frage nach einer sicheren und ausreichenden Lüftung beantwortet werden muss.
Um diesen Zusammenhang klar zu regeln, gibt die DIN 1946-6 vor, dass bei Neubauten und bei wesentlichen Sanierungen ein sogenanntes Lüftungskonzept erstellt werden muss. Dieses Konzept prüft, ob der Luftwechsel allein durch bestehende Undichtigkeiten sichergestellt werden kann, oder ob zusätzliche technische Maßnahmen erforderlich sind. Dabei geht es nicht darum, schon eine detaillierte Lüftungsplanung vorzulegen, sondern zunächst um die grundsätzliche Feststellung: Reicht die vorhandene natürliche Lüftung aus oder ist ein technisches System notwendig?
Die Lüftungsplanung setzt erst dann an, wenn das Konzept ergibt, dass zusätzliche Maßnahmen erforderlich sind. Sie legt fest, wie eine Lüftungstechnik im Detail ausgeführt wird, also welche Geräte oder Systeme zum Einsatz kommen und wie diese dimensioniert sind. Das Lüftungskonzept ist somit die Grundlage, die Entscheidungssicherheit bietet, während die Lüftungsplanung die konkrete Umsetzung beschreibt.
Für Hausbesitzer bedeutet das: Wer sein Gebäude umfassend energetisch saniert, sollte nicht nur an Dämmung und moderne Technik denken, sondern auch an die Sicherstellung einer gesunden Raumluft. Ein Lüftungskonzept nach DIN 1946-6 stellt sicher, dass die Balance zwischen Energieeinsparung und Wohnkomfort gewahrt bleibt – und dass Feuchte- und Schimmelprobleme gar nicht erst entstehen.
Energieberater oder Energieeffizienz-Experte?
Viele Hausbesitzer fragen sich, ob sie für ihr Vorhaben einen Energieberater oder einen Energieeffizienz-Experten benötigen. Beide Begriffe klingen ähnlich, stehen aber für unterschiedliche Rollen und Aufgaben.
Ein Energieberater ist im Allgemeinen ein Fachmann, der sich mit Fragen rund um den Energieverbrauch in Gebäuden beschäftigt. Er analysiert, wo Energieverluste entstehen, gibt Hinweise zu sinnvollen Modernisierungen und zeigt auf, wie sich durch Dämmung, Heizungsoptimierung oder den Einsatz erneuerbarer Energien Kosten sparen lassen. Der Begriff „Energieberater“ ist jedoch nicht geschützt. Zwar haben viele Berater eine entsprechende Weiterbildung absolviert, doch eine einheitliche Ausbildung oder staatliche Anerkennung gibt es nicht.
Ein Energieeffizienz-Experte hingegen ist ein speziell qualifizierter und geprüfter Fachmann, der in die offizielle „Energieeffizienz-Expertenliste für Förderprogramme des Bundes“ eingetragen ist. Um in diese Liste aufgenommen zu werden, ist eine anerkannte Grundqualifikation erforderlich, etwa als Architekt, Ingenieur oder Handwerksmeister, ergänzt durch eine zertifizierte Weiterbildung und regelmäßige Fortbildungen. Der entscheidende Unterschied besteht darin, dass nur Energieeffizienz-Experten berechtigt sind, staatliche Förderprogramme von KfW oder BAfA zu begleiten.
Für Hauseigentümer lässt sich der Unterschied folgendermaßen zusammenfassen: Wer lediglich eine erste Orientierung sucht, zum Beispiel welche Maßnahmen am eigenen Haus grundsätzlich sinnvoll sein könnten, findet in einem Energieberater eine gute Unterstützung. Wer jedoch konkrete Maßnahmen umsetzen und dafür staatliche Zuschüsse oder Förderkredite nutzen möchte, benötigt zwingend einen Energieeffizienz-Experten. Ohne dessen Mitwirkung ist eine Förderung nicht möglich.
So bietet der Energieberater einen guten Einstieg und schafft einen Überblick, während der Energieeffizienz-Experte die entscheidende Instanz ist, wenn es um die Umsetzung und die finanzielle Förderung von energetischen Maßnahmen geht.
Förderhöhen

BEG Einzelmaßnahmen BAfA
Einzelmaßnahmen an der Gebäudehülle, Einbau von Anlagen zur Energieeffizienzerhöhung (z.B. Lüftungsanlage) sowie eine Heizungsoptimierung können über das BAfA gefördert werden. Hierbei können pro Jahr und pro Wohneinheit bis zu 30.000 Euro beantragt werden, wobei Sie grundsätzlich 15 % als Zuschuss nach Abschluss der Sanierungsmaßnahme erhalten.
Mit einem gültigen iSFP erhöht sich die förderfähige Summe auf 60.000 Euro und Sie erhalten einen Bonus von 5 %, womit Sie jährlich insgesamt bis zu 12.000 Euro pro Wohneinheit als Zuschuss zurück erhalten können.
*Die Höhe der tatsächlichen Förderung bemisst sich an den tatsächlich entstandenen, förderfähigen Kosten.

BEG Einzelmaßnahmen KfW
Der Heizungstausch oder die Ergänzung einer bestehenden Heizungsanlage mit erneuerbaren Energien kann über die KfW gefördert werden. Zusätzlich zur Grundförderung von 30 % der anrechenbaren, förderfähigen Kosten können verschiedene Boni gewährt werden. Der Fördersatz ist hierbei aber auf maximal 70 % gedeckelt.
* Für Wärmepumpen bei Nutzung von natürlichen Kältemitteln oder der Nutzung der Wärmequellen Wasser, Erdreich oder Abwasser
** Nur unter bestimmten Voraussetzungen und bei selbstgenutzten Wohneinheiten. Bis 31.12.2028 sind 20 % Bonus erhältlich, danach wird der Bonus alle 2 Jahre jeweils um 3 % reduziert. Ab dem 01.01.2037 entfällt der Bonus.
*** Nur für selbstnutzende Eigentümer mit einem zu versteuernden Haushaltsjahreseinkommen von maximal 40.000 Euro.
BEG Einzelmaßnahmen
Was sind Einzelmaßnahmen? Was ist die Alternative?
Die Bundesförderung für effiziente Gebäude (BEG) bildet den zentralen Rahmen für staatliche Zuschüsse und Kredite im Bereich der energetischen Sanierung und des Neubaus. Innerhalb dieser Förderung gibt es verschiedene Ansätze, die sich in Einzelmaßnahmen und systemische Maßnahmen gliedern.
BEG-Einzelmaßnahmen richten sich an Eigentümer, die gezielt einzelne Bauteile oder Anlagenteile ihres Gebäudes modernisieren möchten. Dazu gehören beispielsweise der Austausch der Heizungsanlage, die Optimierung einer bestehenden Heizung, die Dämmung von Dach, Fassade oder Kellerdecke oder auch der Einbau neuer Fenster und Außentüren. Einzelmaßnahmen können sowohl über die KfW als auch über das BAfA gefördert werden, abhängig von der Art der Maßnahme. Typische Beispiele sind ein durch die KfW geförderter Heizungstausch im Rahmen der BEG-EM oder eine durch das BAfA geförderte Heizungsoptimierung. Die Förderung erfolgt hier in der Regel als direkter Zuschuss, der die Investitionskosten nachträglich reduziert. Zusätzlich gibt es die Möglichkeit, Ergänzungskredite zu nutzen, um die Finanzierung zu ermöglichen. Voraussetzung für die Förderung ist die Einbindung eines Energieeffizienz-Experten.
Die systemischen Maßnahmen innerhalb der BEG – unterteilt in BEG WG (Wohngebäude) und BEG NWG (Nichtwohngebäude) – verfolgen hingegen einen ganzheitlichen Ansatz. Hier geht es nicht um einzelne Bauteile, sondern um das gesamte Gebäude als energetisches System. Eine Sanierung auf Effizienzhaus-Niveau oder der Neubau eines Effizienzhauses fällt in diesen Bereich. Die Förderung richtet sich danach, welchen energetischen Standard das Gebäude nach Abschluss der Maßnahme erreicht. Je ambitionierter das Effizienzhaus-Niveau, desto höher fällt in der Regel auch die Förderung aus. Im Unterschied zu den Einzelmaßnahmen stehen hier zinsgünstige Kredite mit Tilgungszuschüssen im Vordergrund. Diese Kredite werden über die KfW vergeben und kombinieren eine günstige Finanzierung mit einem Zuschuss, der die Rückzahlung reduziert. Da es hier um komplexe Zusammenhänge geht, ist die fachliche Begleitung durch einen Energieeffizienz-Experten verpflichtend.
Zusammengefasst bedeutet das: Einzelmaßnahmen bieten eine gute Möglichkeit, Schritt für Schritt in die energetische Sanierung einzusteigen und gezielt Verbesserungen umzusetzen, die sofort Wirkung zeigen. Sie werden in der Regel mit Zuschüssen unterstützt, die sich durch Ergänzungskredite erweitern lassen. Systemische Maßnahmen hingegen sind sinnvoll, wenn das gesamte Gebäude in einem Zug auf ein neues energetisches Niveau gebracht werden soll, sei es durch eine umfassende Sanierung oder beim Neubau. Hier steht die Kreditförderung mit Tilgungszuschuss im Vordergrund.
In beiden Fällen gilt: Die Wahl der richtigen Maßnahme und die Einbindung eines qualifizierten Experten sind entscheidend, um die passenden Fördermittel zu erhalten und die Maßnahmen optimal umzusetzen.
Wie und wo stelle ich den Antrag für die Förderung?
BEG EM
Für den Heizungstausch / den Einbau eines neuen EE-Wärmeerzeugers ist der Antrag im Kundenportal „Meine KfW“ der KfW zu stellen (siehe FAQ 3.2).
Für sonstige Effizienzmaßnahmen - die Förderung von Maßnahmen an der Gebäudehülle, Anlagentechnik (außer Heizung) oder Heizungsoptimierung sowie die Förderung von Errichtung, Umbau und Erweiterung von Gebäudenetzen - ist der Antrag beim BAFA zu stellen (siehe FAQ 2.2).
Ein Ergänzungskredit ist für Heizungstausch und/oder sonstige Effizienzmaßnahmen erhältlich. Er ist über die Hausbank/Geschäftsbank zu beantragen, die ihn anschließend an die KfW weiterleitet.
BEG WG/ NWG
Für die systemische Sanierung bestehender Wohngebäude (zum Beispiel Eigentumswohnung, Ein- und Mehrfamilienhaus) auf eine Effizienzhaus-Stufe (EH 85 bis EH 40 sowie Denkmal) oder bestehender Nichtwohngebäude (etwa Gewerbegebäude, kommunale Gebäude, Krankenhaus) zum Effizienzgebäude können bei der KfW zinsvergünstigte Kredite mit Tilgungszuschüssen beantragt werden.
Kommunen können zwischen einer Kredit- und einer Zuschussförderung wählen.
Weitere Informationen finden Sie zudem in der Übersicht „Welche Förderungen gibt es und wohin wende ich mich?“.
Quelle: www.energiewechsel.de, Stand 16.06.2025
Ist eine Förderung einer Sanierungsmaßnahme auch ohne iSFP möglich?
Der iSFP ist keine Voraussetzung für die Förderung von Einzelmaßnahmen im Rahmen der Bundesförderung für effiziente Gebäude – Einzelmaßnahmen (BEG EM). Eigentümerinnen und Eigentümer können also auch dann eine Förderung erhalten, wenn sie keine Energieberatung mit iSFP in Anspruch genommen haben.
Allerdings gibt es einen Vorteil, wenn ein iSFP vorliegt: Wird eine im iSFP empfohlene Maßnahme umgesetzt, erhöht sich der Fördersatz um 5 Prozentpunkte – das ist der sogenannte iSFP-Bonus. Dieser Bonus ist also ein Anreiz, aber keine Bedingung für die Förderung.
Wie und wo beantrage ich den Ergänzungskredit für BEG Einzelmaßnahmen? Wie weise ich nach, dass ich mich für den zinsvergünstigten Ergänzungskredit qualifiziere?
Zusätzlich zur Zuschussförderung ist es möglich, einen zinsvergünstigten Ergänzungskredit zur Finanzierung des Heizungstauschs und/oder sonstiger Effizienzmaßnahmen zu erhalten. Dieser wird bei der Hausbank oder einer Geschäftsbank der Wahl beantragt.
Voraussetzung dafür ist die Vorlage einer Zuschusszusage der KfW bzw. eines Zuwendungsbescheids vom BAfA für Sanierungsmaßnahmen nach den seit dem 1. Januar 2024 geltenden Förderbedingungen der BEG EM.
Es gelten grunsätzlich folgende Konditionen:
- Max. Kreditsumme 120.000 Euro pro Wohneinheit
- Zinsgünstiger Kredit
- Zusätzliche Zinsvergünstigung aus Bundesmittlen ist nur erhältlich für selbstnutzende Eigentümerinnen und Eigentümer von Einfamilienhäusern (Gebäude mit einer Wohneinheit) sowie von Eigentumswohnungen in Wohneingentümergemeinschaften (sofern Maßnahmen am Sondereigentum umgesetzt werden) mit bis zu 90.000 Euro zu versteuerndem Haushaltsjahreseinkommen und nur für Maßnahmen an der selbstgenutzten Wohneinheit
- Zinsbindungsfrist max. 10 Jahre
- Nach Ablauf der Zinsbindung erfolgt ein Prolongationsangebot der KfW ohne Zinsverbilligung aus Bundesmitteln
Weitere Informationen finden Sie auf den folgenden Produktseiten der KfW:
Einzelmaßnahmen Ergänzungskredit – Wohngebäude (358,359)
Einzelmaßnahmen Ergänzungskredit – Nichtwohngebäude (523)
Zur Berechnung des Haushaltsjahreseinkommens wird der Durchschnitt aus den zu versteuernden Einkommen des zweiten und dritten Jahres vor Antragstellung ermittelt, d.h. für einen Antrag im Jahr 2024 wird der Durchschnitt der Einkommen aus 2021 und 2022 gebildet. Das Haushaltsjahreseinkommen ergibt sich aus den zu versteuernden Einkommen eines Kalenderjahres der relevanten Haushaltsmitglieder.
Relevante Haushaltsmitglieder sind alle zum Zeitpunkt der Antragstellung in einer Wohneinheit mit Haupt- oder alleinigem Wohnsitz gemeldeten volljährigen Eigentümerinnen und Eigentümer sowie deren dort mit Haupt- oder alleinigem Wohnsitz gemeldeten Ehe- und Lebenspartnerinnen/-partner oder Partnerinnen/Partner aus eheähnlicher Gemeinschaft
Das zu versteuernde Haushaltsjahreseinkommen wird anhand der Einkommensteuerbescheide des Finanzamtes nachgewiesen. Weitere Möglichkeiten zum Nachweis für Rentnerinnen und Rentner werden in der FAQ 3.9 aufgeführt.
Quelle: www.energiewechsel.de, Stand 23.06.2025
Wie kann eine Wohneigentümergemeinschaft (WEG) einen Antrag für eine Sanierung stellen?
Hierbei ist zu unterscheiden zwischen Maßnahmen am Gemeinschaftseigentum und Maßnahmen am Sondereigentum. Welche Gebäudeteile zum Sonder- oder zum Gemeinschaftseigentum gehören, ist allgemein im Wohnungseigentumsgesetz (WEG) und im Detail in der Teilungserklärung der Wohnungseigentümergemeinschaft geregelt.
Bei Maßnahmen am Gemeinschaftseigentum stellt der Verwalter der WEG oder eine andere vertretungsberechtigte Person als bevollmächtigte Person der WEG einen gemeinschaftlichen Antrag auf Grundlage entsprechender Beschlüsse der WEG zur Sanierung und Antragstellung. In der Zuschussvariante ist bei der Antragstellung für Maßnahmen am Gemeinschaftseigentum ein entsprechender aktueller Nachweis hochzuladen, zum Beispiel eine Vollmacht der Eigentümerinnen und Eigentümer, Verwalterbestellung (inkl. Angabe eines aktuell gültigen Bestellungszeitraums) oder Beschluss der WEG-Versammlung zur Vertreterbestellung bzw. zur geplanten Maßnahme.
Bei förderfähigen Sanierungsmaßnahmen ausschließlich am Sondereigentum einer Wohnungseigentümerin bzw. eines Wohnungseigentümers muss diese Wohnungseigentümerin bzw. dieser Wohnungseigentümer einen gesonderten Antrag stellen.
Quelle: www.energiewechsel.de, Stand 23.06.2025
Individueller Sanierungsfahrplan iSFP
Was ist die geförderte Energieberatung / ein iSFP?
Der iSFP ist ein Planungsinstrument, das Eigentümer Schritt für Schritt bei der energetischen Sanierung unterstützt, den Energieverbrauch langfristig zu senken, den Wohnkomfort zu erhöhen und den Immobilienwert zu erhalten.
Ein zertifizierter Energieberater nimmt den aktuellen Zustand Ihrer Immobilie auf und analysiert ihn auch auf konstruktive sowie bauphysikalische Zusammenhänge zur Vermeidung von Schäden und Reduktion von Folgekosten. Darauf aufbauend empfiehlt er realistische und aufeinander abgestimmte Maßnahmen, die zeitlich sinnvoll umgesetzt werden können, Ihre individuellen Wünsche sowie Ihr Budget und Folgeeffekte gesteigerter Behaglichkeit berücksichtigen. So ermöglicht der iSFP eine fundierte Planung von der Finanzierung bis zur Umsetzung und bietet Transparenz zu Einsparpotenzialen, Kosten und Förderoptionen.
Ein wesentlicher Bestandteil ist der Vor-Ort-Termin mit detaillierter Bestandsaufnahme und Beratungsgespräch, in dem Sie gemeinsam mit dem Experten offene Fragen klären und das weitere Vorgehen abstimmen. Neben energetischen Aspekten können hier auch andere Modernisierungswünsche wie ein altersgerechter Umbau oder Wohnflächenerweiterungen einfließen.
Im Rahmen der Analyse wird zunächst der energetische Ist-Zustand Ihres Gebäudes umfassend erfasst. Dazu gehört eine detaillierte Beschreibung aller relevanten Gebäudeeigenschaften, wie Baujahr, Nutzung, Anzahl der Wohneinheiten sowie der bauliche Zustand von Fenstern, Türen, Wänden, Dach und Decken. Zusätzlich wird die vorhandene Heizungs- und Warmwasserbereitungsanlage genau untersucht. Auf Basis dieser Bestandsaufnahme wird eine Energiebilanz erstellt, die Einsparpotenziale sichtbar macht. Der Energieberater prüft technologieoffen, hersteller- und produktneutral mögliche Maßnahmen zur Nutzung erneuerbarer Energien, sofern diese technisch umsetzbar und wirtschaftlich sinnvoll sind.
Je nach Bedarf können zwei bis fünf Maßnahmenpakete mit mehreren Sanierungskomponenten erstellt werden, die zeitlich, kostenmäßig und hinsichtlich der Förderfähigkeit optimal aufeinander abgestimmt sind. Alternativ ist auch ein einzelnes Maßnahmenpaket möglich, das die Sanierung in einem Schritt auf einen Effizienzhaus-Standard vorsieht.
Wenn mehrere Sanierungsstrategien möglich sind, wählen Sie in Abstimmung mit dem Energieberater ein passendes Konzept aus. Anschließend erhalten Sie zwei Dokumente: „Mein Sanierungsfahrplan“, der die Situation und Maßnahmen übersichtlich darstellt, sowie die „Umsetzungshilfe“, die detaillierte Informationen zu den Schritten enthält.
Die Erstellung des iSFP wird durch die Bundesförderung für Energieberatung für Wohngebäude (EBW) unterstützt:
- mit 50 % der Beratungskosten bis zu 650 Euro für Ein- und Zweifamilienhäuser
- mit 50 % der Beratungskosten bis zu 850 Euro für größere Wohngebäude
- zusätzliche Förderung für Wohnungseigentümergemeinschaften (WEG) von 250 Euro Erläuterungszuschuss im Rahmen einer WEG-Versammlung
Mit einem gültigen iSFP erhalten Sie einen Bonus von 5 % auf die Förderung für Einzelmaßnahmen an der Gebäudehülle und der Heizungsoptimierung. Außerdem verdoppelt sich die maximale förderfähige Investitionssumme von 30.000 auf 60.000 Euro je Wohneinheit, Maßnahme und Kalenderjahr. So können Sie jährlich pro Maßnahme und Wohneinheit bis zu 7.500 Euro mehr Förderung erhalten. Der iSFP gilt 15 Jahre; Maßnahmen, die danach umgesetzt werden, sind von der iSFP-Zusatzförderung ausgeschlossen.
Ziel der geförderten Beratung ist es, die energetisch sinnvollste Sanierungslösung zu finden – sei es in mehreren Etappen oder als Komplettsanierung. Der iSFP folgt dem „Bestmöglich-Prinzip“ mit Fokus auf hohe Energieeinsparung und umfassende CO₂-Reduktion, sowohl für Gebäudehülle als auch Anlagentechnik.
Wie und wo stelle ich den Antrag für die Förderung?
Bevor Sie mit Ihrem Vorhaben beginnen, reichen Sie ganz einfach Ihren Antrag auf Förderung einer Energieberatung über das BAFA-Portal (»+ Neuer Antrag«) ein.
Wenn Sie noch kein Benutzerkonto im BAFA-Portal haben, dann registrieren Sie sich zuerst.
Nach der Registrierung erhalten Sie eine E-Mail mit einem Aktivierungslink für den Zugang zum BAFA-Portal. Dieser Link ist einmalig für 7 Tage gültig. Sollten Sie einen neuen Aktivierungslink benötigen, können Sie diesen über »Probleme bei der Anmeldung?« auf der Anmeldeseite des BAFA-Portals anfordern.
Wichtig: Bitte lesen Sie vor Antragstellung die Hinweise im Dokument Merkblatt zur Antragstellung über das BAFA-Portal (PDF, 959KB, Datei ist nicht barrierefrei).
Aktuell beträgt die Bearbeitung der Anträge etwa 2 Wochen.
Das BAFA-Portal ist Ihre zentrale Schnittstelle, um eine schnelle Übersicht über Ihre Aktivitäten und Vorgänge zu erhalten. Hier können Sie sowohl Anträge stellen, bearbeiten und deren Status überprüfen als auch Anträge stornieren. Daneben bietet Ihnen das Portal die Möglichkeit das Online-Formular „Verwendungsnachweis“ auszufüllen sowie Ihre persönlichen Kontaktdaten zu ändern.
Quelle: www.bafa.de, Stand 23.06.2025
Was ist das Bestmöglich-Prinzip?
Das Bestmöglich-Prinzip ist ein zentrales Leitmotiv innerhalb der Energieberatung, insbesondere bei der Erstellung des individuellen Sanierungsfahrplans (iSFP). Es dient als fachliche und politische Orientierungshilfe, um Gebäude langfristig möglichst energieeffizient zu gestalten und damit einen Beitrag zur Erreichung der nationalen Klimaziele zu leisten – vor allem dem Ziel, bis 2050 einen nahezu klimaneutralen Gebäudebestand zu erreichen.
Worum geht es beim Bestmöglich-Prinzip konkret?
Im Kern bedeutet das Bestmöglich-Prinzip, dass bei der Beratung und Planung von energetischen Sanierungsmaßnahmen alle relevanten Faktoren zur Senkung des Primärenergiebedarfs eines Gebäudes bestmöglich berücksichtigt werden sollen. Dazu zählen etwa Verbesserungen an der Gebäudehülle, der Anlagentechnik sowie die Nutzung erneuerbarer Energien. Es geht also darum, für jedes Gebäude – unter Berücksichtigung seiner baulichen Gegebenheiten und der individuellen Situation der Eigentümer – den energetisch sinnvollsten und zukunftsfähigsten Sanierungsweg aufzuzeigen.
Ist das Bestmöglich-Prinzip eine verbindliche Vorgabe?
Nein, das Bestmöglich-Prinzip ist keine rechtlich verpflichtende Anforderung, sondern eine fachliche Empfehlung bzw. Zielsetzung. Es versteht sich als Willensbekundung zur bestmöglichen Beratung – nicht als festgeschriebene Leistung. Dennoch sollte es von Energieberaterinnen und -beratern ernst genommen werden, um möglichst große Energieeinsparungen und CO₂-Reduktionen zu erzielen. Wenn der höchste Effizienzstandard im Einzelfall nicht möglich oder wirtschaftlich nicht vertretbar ist, kann auf einen niedrigeren Standard ausgewichen werden – dies muss jedoch nachvollziehbar begründet und dokumentiert werden.
Warum ist das Prinzip so wichtig für den iSFP?
Viele Bauteile und technische Anlagen eines Gebäudes haben eine Lebensdauer von mehreren Jahrzehnten. Für viele davon ergibt sich im Zeitraum bis 2050 nur noch eine einzige Möglichkeit zur Sanierung. Wenn diese Gelegenheiten nicht konsequent genutzt werden, wird es schwer, die langfristigen Klimaziele zu erreichen. Daher sollte bei jeder Einzelmaßnahme oder jedem Maßnahmenpaket im Rahmen des iSFP geprüft werden, ob sie dem bestmöglichen energetischen Standard entsprechen – frei nach dem Motto: „Wenn schon, denn schon.“
Wie wird das Prinzip in der Praxis angewendet?
Im Rahmen des iSFP bedeutet das Bestmöglich-Prinzip, dass für jede Maßnahme die energetisch beste technisch umsetzbare Lösung vorgeschlagen werden sollte. Dies betrifft sowohl die Gebäudehülle als auch die Anlagentechnik und die Nutzung erneuerbarer Energien. Ziel ist es, bei jeder Maßnahme eine Verbesserung zu erzielen, die sich möglichst an den höchsten Effizienzklassen orientiert. Dabei müssen allerdings auch die individuellen finanziellen und persönlichen Rahmenbedingungen der Gebäudeeigentümer berücksichtigt werden.
Was passiert, wenn das Bestmöglich-Prinzip nicht vollständig umsetzbar ist?
Es ist nicht immer möglich oder sinnvoll, für jedes Gebäude den höchsten Effizienzstandard zu erreichen. In solchen Fällen soll geprüft werden, ob zumindest ein etwas niedrigerer, aber immer noch förderfähiger Standard realisiert werden kann. Ist auch das nicht machbar, muss die Entscheidung und ihre Gründe im Beratungsbericht ausführlich begründet werden. Wichtig ist in jedem Fall, dass alle Vorschläge nachvollziehbar und im Einklang mit den langfristigen energetischen Zielsetzungen stehen.
Fazit: Das Bestmöglich-Prinzip fordert von Energieberaterinnen und -beratern, vorausschauend, ambitioniert und zugleich realistisch zu planen – im Sinne einer wirksamen, langfristig tragfähigen und auf die Eigentümer zugeschnittenen energetischen Sanierungsstrategie.
Müssen die empfohlenen Maßnahmen im Sanierungsfahrplan umgesetzt werden, um den iSFP-Bonus der Förderung zu erhalten?
Die Maßnahmen, die im individuellen Sanierungsfahrplan (iSFP) beschrieben sind, müssen nicht exakt in der vorgeschlagenen Form umgesetzt werden, um den Förderbonus – den sogenannten iSFP-Bonus – zu erhalten. Vielmehr kommt es darauf an, dass die tatsächliche Sanierungsmaßnahme inhaltlich dem entspricht, was im iSFP empfohlen wurde.
Das bedeutet, dass die Maßnahme grundsätzlich zum Konzept des Sanierungsfahrplans passen und im Sinne der dort verfolgten energetischen Zielsetzung stehen muss. Es ist dabei zulässig, von Details wie der genauen technischen Ausführung, dem Produkt oder dem Zeitpunkt der Umsetzung abzuweichen, solange die Maßnahme dem angestrebten energetischen Effekt dient und die technischen Mindestanforderungen der Förderung erfüllt werden.
Der Erhalt des Förderbonus von 5 % setzt voraus, dass die Maßnahme innerhalb der Gültigkeitsdauer des iSFP, also in der Regel innerhalb von 15 Jahren, umgesetzt wird. Der iSFP-Bonus kann allerdings nur bei Einzelmaßnahmen in Anspruch genommen werden, nicht bei einer kompletten Effizienzhaus-Sanierung.
Zahlen und Fakten
dena-Gebäudereport 2026
Zahlen, Daten, Fakten zum Klimaschutz im Gebäudebestand
Zur PDF klicken Sie hier.
Quelle: www.gebaeudeforum.de/wissen/zahlen-daten/gebaeudereport-2026, Stand 28.01.2026
dena-Gebäudereport 2025
Zahlen, Daten, Fakten zum Klimaschutz im Gebäudebestand
Zur PDF klicken Sie hier.
Quelle: www.dena.de/infocenter, Stand 23.06.2025
dena-Gebäudereport 2025 – Updatebericht April
Neue Daten zu Wärmeerzeugern, Energieverbrauch, CO₂-Emissionen, Baukosten und Förderzahlen – ergänzt um eine Analyse zur Verbreitung von PV.
Zur PDF klicken Sie hier.
Quelle: www.dena.de/infocenter, Stand 23.06.2025
Klimaneutraler Gebäudebestand 2050
Energieeffizienzpotenziale und die Auswirkungen des Klimawandels auf den Gebäudebestand
Zur PDF klicken Sie hier.
Quelle: www.umweltbundesamt.de, Stand 23.06.2025
Investitionen - Deutsches Institut für Wirtschaftsforschung e.V.
Energetische Gebäudesanierung: Investitionen preisbereinigt weiter rückläufig
Zur Pressemitteilung klicken Sie hier.
Quelle: www.diw.de, Stand 23.06.2025
Nützliche Weblinks
Gebäudeenergiegesetz GEG
Geförderte Energieberatung iSFP
Bundesförderung Energieberatung für Wohngebäude (EBW)
Antragstellung Förderung EBW:
Fachinformationen zum iSFP
BEG-Einzelmaßnahme
Einzelmaßnahmen BAfA
Einzelmaßnahme KfW (Heizungstausch)
KfW-Effizienzhaus
Effizienzhaus-Sanierung BEG WG
Klimafreundlicher Neubau KFN
Klimafreundlicher Neubau Niedrigpreissegment KNN
Übersichten Förderprogramme
BEG-Förderprogramme
https://oekozentrum.nrw/aktuelles/detail/news/bundesfoerderung-fuer-effiziente-gebaeude-beg/
Fördermittel-Datenbank Bundesbaublatt
https://www.bundesbaublatt.de/foerdermittel-3276592.html
KfW-Förderprodukte Bestandsgebäude
KfW-Förderprodukte Neubau
Bauphysik